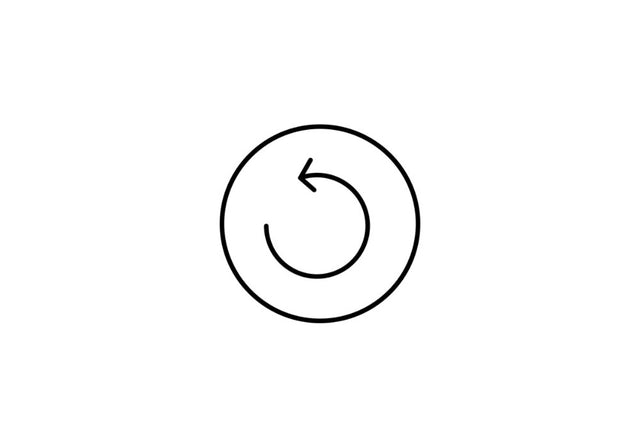Zurück. In die Zukunft.
Jürgen Nerger – 29. Juli 2025Über die radikale Kraft des Rückbaus.
Wir müssen lernen, Dinge wieder einzusammeln, statt sie endlos weiterzuspielen. Es gibt Entscheidungen und Entwicklungen, die hatten eine gute Grundidee, waren in der Umsetzung aber großer Mist. Jedenfalls für einen beträchtlichen Teil der Betroffenen. Spotify für Künstler. Airbnb für Innenstädte. Online-Journalismus ohne Bezahlung. Jeder Ort, an dem kreative Autonomie durch Plattformdynamik ersetzt wurde. Dazu gehören auch automatisierte Kundenbetreuung oder Bewertungssysteme in der Arbeitswelt, bei denen man einen UBER-Fahrer mit Sternchen „gamifiziert“. Der eigentliche Fehler liegt nicht einmal im Irrtum selbst – der liegt im irreversiblen Denken. Denn was einmal eingeführt wurde, bleibt. Was einmal „gelauncht“ wurde, läuft. Und was einmal als „Gamechanger“ gefeiert wurde, ist nie wieder nur ein schlechter Prototyp, sondern ab sofort the new normal. Wir leben in einem Fortschrittsbetrieb ohne Rückgaberecht. Ohne Knopf für:
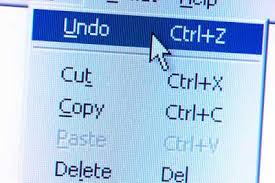
War nix. Zurück auf Anfang!
Die kulturelle, kreative und gesellschaftliche Landschaft wird seit Jahren von Plattformen, Prozessen und Pitches umgepflügt. Man könnte auch sagen: niedergewalzt. Ganze Branchen wurden "optimiert", bis sie nicht mehr konnten. Oft mit dem Versprechen: besser, schneller, smarter. Und es wurde: leerer, banaler, algorithmischer. Doch statt zu sagen: „War ein Fehler. Lass mal schnell zurückdrehen.“, wird weitergepowert. Noch ein Feature. Noch ein Add-on. Noch ein Tool. Hauptsache, nie zurück. Hauptsache, nie die Frage stellen:
Wozu das alles überhaupt?
Und währenddessen spielen wir alle fleißig mit. Weil „es halt jetzt so ist“. Weil man „ja nichts machen kann“. Weil Rückzieher nach Schwäche riechen und niemand der Erste sein will, der sich traut, mal den Stecker zu ziehen. Stell dir vor, Chirurgen dürften neue OP-Methoden anwenden, aber nie wieder zurück zur bewährten Technik wechseln. Oder dein Lieblingsbuchladen wird durch einen unpersönlichen Bücher-Automaten ersetzt und niemand darf das je wieder in Frage stellen. Stell dir vor, eine Stadt plant ihren gesamten Verkehr um, damit es besser wird, aber es wird schlimmer und alle sagen nur: „Tja, Pech. Jetzt ist das eben so“. Ach, Momentchen, gibt’s ja alles schon! Diese Denkweise hat sich längst durchgesetzt. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Kultur. Alles ist Beta, nichts ist rückbaubar. Es gibt Exit-Strategien für Unternehmen, aber keine für schlechte Ideen. Warum denn eigentlich nicht?
Mut zur Reue
Wir haben gelernt, wie man launcht, wie man skaliert, wie man durchdrückt. Was uns fehlt, ist der Mut zur Reue. Die Fähigkeit, etwas einzuräumen: Öffentlich, sichtbar, gemeinsam. Nicht als furchtbares Drama. Sondern als pures Zeichen von Intelligenz. Was wäre es für ein Fortschritt, wenn man sagen könnte: „Das hier war leider eine doofe Entscheidung. Wir machen es wieder anders.“ Ohne Imageverlust. Ohne Gesichtsverlust. Ohne dass gleich eine ganze Branche implodiert.
Rückbau ist kein Rückschritt
Rückeroberung ist kein Romantizismus. Sie ist eine bewusste, kreative Handlung. Die Wiederentdeckung des Echten. Die Rückgewinnung von Kontrolle. Die Verweigerung, jede neue Option als Verbesserung zu akzeptieren. Man muss doch nicht alles weiterspielen, nur weil es auf dem Tisch liegt. In einer Welt, die von Automatisierung und Plattformisierung erschöpft ist, ist Rücknahme kein Scheitern, sondern ein Akt der Selbstbestimmung. Ein deutliches: „Nicht mit mir.“
Schluss mit Dauer-Updates
Ich wünsche mir ein kulturelles Veto-Recht. Ein kollektives „Danke, reicht jetzt“. Nicht aus Prinzip, sondern aus Erfahrung. Nicht rückwärtsgewandt, sondern nach vorn gerichtet und mit einem klaren Blick auf das, was uns wirklich wichtig ist. Nicht alles, was möglich ist, muss auch bleiben. Nicht alles, was neu ist, ist auch besser. Man muss auch mal loslassen können. Von Ideen. Auch mal von sich selbst.