Mehr Kultur, weniger Kirmes.
Jürgen Nerger – 07. Oktober 2025Warum Kultur plötzlich bimmelt und blinkt. Und wie man darauf reagieren sollte.
Die Zukunft der Kultur riecht ziemlich streng nach Popcorn. Zumindest fühlt es sich manchmal so an: Wir gehen in eine Ausstellung und werden von einer freundlichen Stimme in einen „immersiven Parcours“ eingeladen. Es gibt einen Selfie-Spot, eine AR-Station, ein „Quiz zum Mitmachen“, am Ende einen Shop mit Limited Edition-Socken und irgendwo dazwischen hängt tatsächlich auch noch Kunst. Bei Lesungen stehen Nebelmaschinen direkt neben dem Signiertisch, bei Konzerten wird das Publikum in Farbgruppen eingeteilt, damit die Drohne im Refrain ein Herz in die Menge malen kann. Und selbst bei Corporate Events heißt es: Escape Room meets Silent Disco meets Markenkern.
Die Diagnose ist nicht neu: Aufmerksamkeit ist ein verdammt knappes Gut, Konkurrenz ist irgendwie alles, Kultur muss deshalb „erlebbar“ sein. Was allerdings neu ist: Die Inszenierung scheint den Kern aufzufressen. Wir bauen Rahmenhandlungen, um Inhalte zu tragen, und wundern uns, wenn der Rahmen lauter wird als das Bild. „Erlebnis“ ist vom Ergebnis zur Voraussetzung geworden. Wer heute nur eine Bühne, einen Text, ein Bild oder einen Song anbietet, gilt schnell als unzeitgemäß. Das Problem: Wenn alles Bonus ist, weiß niemand mehr, was die Hauptsache war.
Wie immer scheint es dafür gute Gründe zu geben. Die „Eventisierung“ ist eine Reaktion auf die Timeline-Logik: Kultur konkurriert nicht mehr mit Kultur, sondern mit allem. Wenn TikTok die Latte legt, versucht das Museum eben mitzuhalten. Mit Licht, Klang, Worten, Animationen. Der Lesesaal wird zur Blackbox, die Besucherführung zur Choreografie. Es bleibt nur die Frage, wann das alles kippt. Wann wird aus „Zugang schaffen“ ein „Zugeständnis machen“? Zwischen Einladung und Animation liegt ein schmaler Steg. Wer danebentritt, landet im Mitmach-Becken – chlorfrei, aber flach.
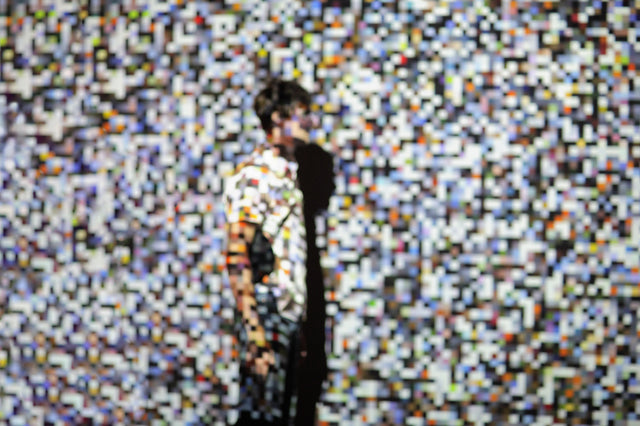
Aus der Praxis
An dieser Stelle ein paar Beobachtungen aus der Praxis:
1) Gamification ist kein Ersatz für Bedeutung.
Ein Punktesystem, ein Stempelpass, ein Rätsel, alles fein. Aber Spiele lösen nicht automatisch das Problem, dass Inhalte mitunter schwer sind. Sie vermarkten Schwieriges, sie ersetzen es aber nicht. Das Spiel ist die Verpackung, nicht der Stoff. Wer das verwechselt, bekommt Lernstationen, die gut geklickt, aber schlecht erinnert werden.2) Die Dramaturgie gehört dem Inhalt.
Viele Events starten heute mit einer Hürde: Registrierung, App-Download, Badge, Tutorial. Danach eine Abfolge von „Wow“-Momenten, die in einer Dramaturgie liegen, die von außen kommt. Oft technisch, selten poetisch. Dabei schafft Kunst seit Jahrhunderten Dramaturgien ohne App-Update. Die innere Spannung eines Werkes ist doch die eigentliche Maschine. Technik darf das verstärken, sollte es aber nicht übertönen.3) Der neue Luxus heißt Stille.
Je mehr Geräuschkulissen wir bauen, desto wertvoller wird das, was nichts macht: ein Raum, in dem man eine Sache ungestört und ohne Anreizschleife wahrnimmt. Keine Filter, kein „Teile jetzt!“, keine Auszeichnung für „fünf Stationen geschafft“. Ausgerechnet im Zeitalter der Experience Economy wird das Einfach-Da-Sein zur Premiumkategorie.Es gibt aber auch hervorragende Gegenbeispiele. Ausstellungen, die digitale Mittel präzise einsetzen, um Unsichtbares sichtbar zu machen. Lesungen, die mit Sound und Licht arbeiten, weil der Text es verlangt, nicht weil die Technik da ist. Konzerte, die Raum und Publikum so ernst nehmen, dass auch ein Flüstern trägt. Und Corporate Formate, die tatsächlich Erkenntnis stiften, nicht nur Aufenthaltsqualität. Damit es nicht abstrakt bleibt, drei konkrete Beispiele:
- Marina Abramović – The Artist Is Present (MoMA): Null Technik, maximale Spannung. Eine Person, ein Stuhl, Zeit. Erlebnis entsteht aus Aufmerksamkeit, nicht aus Apparatur.
- Tiny Desk Concerts (NPR): Kein Laser, kein Nebel: Nähe als Dramaturgie. Musiker in Armlänge und plötzlich hört man wieder die Pausen.
- Patagonia – Worn Wear (Pop-up-Repair): Corporate ohne Kirmes. Statt Fotospiegel: Reparaturtisch. Das Erlebnis ist Beteiligung am Sinn oder Nachhaltigkeit als Handlung Und nicht als Hashtag.
Es geht also nicht darum, die Spielereien zu verteufeln. Es geht nur darum, sie zu begründen.
Wie weiter?
Und weil wir das Thema gern ins Leichte ziehen: Die schönsten Erlebnisse sind oft die unökonomischen. Die Dinge, die sich nicht rechnen. Das Gespräch hinter einer Säule. Ein falscher Einstieg, der sich dann als richtig herausstellt. Ein Satz, der nicht sofort verstanden wird. Eine Minute zu viel Dunkelheit.
Wir haben sehr lange Erlebnis simuliert, um zu merken, dass Erfahrung etwas anderes ist. Erlebnis ist das, was auf dem Plan stand. Erfahrung ist das, was bleibt. Erlebnis lässt sich buchen, Erfahrung nur riskieren. Das Risiko, also die Möglichkeit, dass etwas nicht gelingt, ist aus vielen Veranstaltungen verschwunden. Kein Wunder, dass sich dann alles nach Freizeitpark anfühlt.
Wie also weiter? Mit Mut zum Weglassen. Mit Programmen, die Vertrauen in das Publikum haben: dass Menschen sich auf etwas einlassen können, ohne dass man ihnen permanent das Händchen hält.
Kultur sollten wir wieder häufiger an Nachklang messen, nicht an „Engagement“.
Was lässt dich nachts nicht schlafen und begleitet dich noch morgens auf dem Weg zur Arbeit? Welcher Satz, welcher Blick, welches Bild, welcher Song? Wenn der Rahmen leiser ist als das Bild, wenn Technik leiser ist als die Frage, wenn wir leiser sind als der Moment, dann erst war’s wirklich groß.


