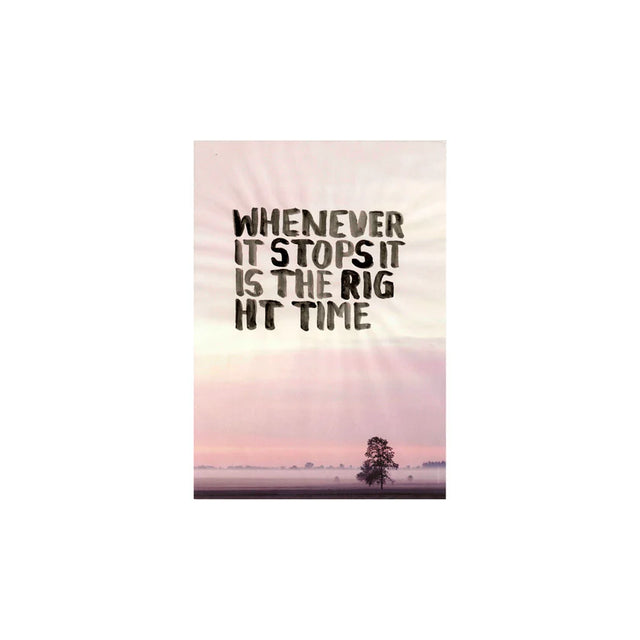Die Unsichtbaren
Jürgen Nerger – 02. September 2025Die stille Revolution der Kulturarbeitenden
Wer im Theater sitzt, sieht die Schauspielerin. Wer auf dem Festival tanzt, hört die Band. Wer ein Magazin in den Händen hält, liest die Worte. Aber wer sieht die, die stundenlang Kabel ziehen, Bühnen aufbauen, Texte lektorieren, Rechnungen schreiben, Licht setzen, Plakate kleben, Flyer verteilen, bis spät in die Nacht proben. Ohne jemals im Rampenlicht zu stehen?
Kulturarbeitende sind die unsichtbaren Hände einer Gesellschaft. Sie sind da, wenn wir feiern, wenn wir nachdenken, wenn wir trauern, wenn wir uns inspirieren lassen. Und doch verschwinden sie selbst oft in der Unsichtbarkeit. Wir reden von Künstlerinnen, Stars, Intendantinnen, Bestsellerautoren. Aber die Abertausenden, die Kultur täglich ermöglichen, bleiben meistens eine Randnotiz.
Die Wahrheit ist unbequem: Kulturarbeit ist in großen Teilen prekär. Viele hangeln sich von Projekt zu Projekt, schlecht bezahlt, ohne Sicherheit, ohne Absicherung im Alter. Die Pandemie hat das gnadenlos offengelegt: Bühnen leer, Clubs geschlossen, Lesungen abgesagt. Plötzlich standen nicht nur Künstlerinnen ohne Einkommen da, sondern auch Techniker, Booker, Designerinnen, Tontechniker, Maskenbildner, Cutterinnen. Ganze Existenzen verschwanden im Schatten der Verordnungen.
Und das Paradoxe: Genau in dieser Zeit wurde deutlich, wie unverzichtbar Kultur ist. Menschen schauten Serien, hörten Musik, lasen Bücher, streamten Theaterstücke. Alles Kulturprodukte, alles Arbeit. Aber die, die diese Arbeit geleistet haben, standen ohne Netz da. Als würde man von Ärztinnen und Ärzten verlangen, Leben zu retten, ihnen aber den Zugang zum Operationssaal verweigern.
Abhängigkeit
Die Abhängigkeit von Mäzenen, Höfen, Kirchen hat Kultur schon immer geprägt. Damals wie heute bestimmt, wer zahlt, auch das, was entstehen kann. Nur die Finanzierungsquellen haben sich verändert. Heute heißen sie Förderprogramme, Stiftungen, Sponsoren oder Plattformen. Das Prinzip aber bleibt: Kulturarbeitende sind von Strukturen abhängig, die sie nicht selbst bestimmen.
Und trotzdem haben sie Gesellschaften geprägt wie kaum jemand sonst. Nicht die großen Herrscher, sondern die zahllosen Handwerker, Musikerinnen, Schreiber und Gestalterinnen haben Epochen getragen. Das Bauhaus etwa entstand nicht aus einem Regierungsprogramm, sondern aus dem Zusammenspiel vieler, die Architektur, Design und Kunst neu dachten – und damit bis heute wirken. Auch der Jazzclub in New Orleans oder die Punk-Szene in London zeigen, dass kulturelle Bewegungen nicht im Parlament beginnen, sondern in Kellern, Hinterhöfen, Werkstätten.
Und doch bewegt sich etwas. Kulturarbeitende beginnen, sich anders zu organisieren. Genossenschaften entstehen, solidarische Fonds, neue Verteilungsmodelle. Digitale Abo-Systeme, Crowdfunding, Substack, Patreon, Streaming sind Versuche, sich der Logik des Prekariats zu entziehen und sich direkt mit dem Publikum zu verbinden. Nicht alles funktioniert, manches verstärkt leider nur die Abhängigkeiten. Aber etwas verändert sich langsam: das Selbstbewusstsein.
Revolution
Die Revolution ist still, weil sie nicht in Barrikadenbildern erscheint, sondern in Netzwerken, Zusammenschlüssen, neuen Modellen. Immer mehr Kulturarbeitende fordern Anerkennung ihrer Arbeit als Arbeit. Nicht als Hobby, nicht als „Herzensprojekt“, nicht als etwas, das man nebenbei macht.
Ohne faire Bedingungen für Kulturarbeit gibt es keine Kultur. Und ohne Kultur gibt es keine Gesellschaft, die diesen Namen verdient. Eine Demokratie, die ihre Kulturarbeitenden im Stich lässt, lässt ihr eigenes Immunsystem im Stich. Die eigentliche Wertschöpfung entsteht nicht in den Laboren der Tech Konzerne, sondern dort, wo Menschen Sprache, Bilder und Klänge schaffen, die uns als Gesellschaft prägen. Dabei sind es nicht immer die großen Innovationen, die Identität stiften, sondern die vielen kleinen, stillen Taten.
Diese stille Revolution ist ein Lackmustest für unsere Gesellschaft. Er zeigt, ob wir bereit sind, Arbeit nicht nur nach Marktlogik zu bewerten, sondern nach ihrem Wert für das Zusammenleben. Es ist leicht, von Kultur als Standortfaktor zu reden, wenn man Festivals in die Tourismusbroschüre schreibt. Schwerer ist es, Kulturarbeit als das zu sehen, was sie ist: Grundversorgung.
Kulturschaffende bauen keine Brücken aus Beton. Sie bauen Brücken zwischen Menschen. Sie schaffen Resonanzräume, ohne die eine Gesellschaft schlicht verstummt. Und wenn wir sie weiter unsichtbar machen, werden wir eines Tages merken: