Bitte nicht füttern
Jürgen Nerger – 30. September 2025Der stille Siegeszug der Bots.
Es beginnt zumeist harmlos: ein Kommentar unter deinem Post antwortet innerhalb eines Augenzwinkerns, nennt dich beim Vornamen und wiederholt elegant deine steile These. Nur eine Spur glatter, als Menschen normalerweise schreiben. In deinem Postfach bedankt sich ein „Customer Care“-Team für etwas, das du nie gekauft hast. Und auf der Produktseite deines neuen Lieblingsgadgets riecht jede zweite Rezension nach Pfefferminztee und maschineller Höflichkeit. Und du denkst: „Ach, dass Internet eben.“ In Wahrheit aber sitzt du im größten Zwiegespräch der Gegenwart, zwischen Menschen und Maschinen, und hast es kaum gemerkt.
Das Netz ist heimlich, still und leise entmenschlicht worden. Zum ersten Mal, seit es das Web gibt, stammt mehr als die Hälfte des Traffics nicht von Menschen. Und über ein Drittel davon sind „Bad Bots“, also automatisierte Programme, die klicken, crawlen, kaufen, lügen, kopieren und verführen. Echt jetzt? Das sagen die Zahlen aus dem aktuellen Imperva-Report: 51 % automatisierter Traffic, 37 % davon „bad“.
Bots sind keine Science-Fiction, sie sind gängige Infrastruktur. Sie sammeln Preise, überbieten dich bei Konzerttickets, testen Passwörter, füllen Kontaktformulare aus, bestellen Turnschuhe in Größen, die es nicht gibt, und hinterlassen Kommentare, die so klingen, als hätte ein höflicher Austauschschüler die Welt verstanden. Die neue Generation tarnt sich mit „residential proxies“ als Nachbarin von nebenan. Die IP wirkt bürgerlich, die Absicht allerdings nicht.
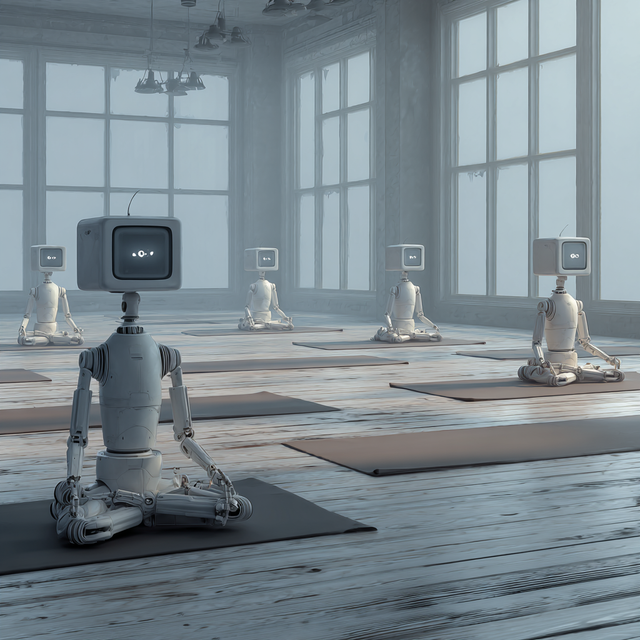
Audio-Bot-Drop:
Zero-Click
Das Perfide ist ja nicht, dass Maschinen Dinge automatisieren. Das Perfide ist, dass sie Öffentlichkeit imitieren. Nehmen wir mal die Nachrichtenportale: Das Team von NewsGuard zählt über 1.200 Websites, die fast ohne menschliche Redaktion, dafür mit generativer KI, „Nachrichten“ ausspucken. Von „Local News Daily“ bis „Science Today Now“, alles seriös klingende Fassaden. Manche recyceln Agenturmeldungen nur, andere fantasieren einfach drauflos. Ergebnis: Die Fassade „Presse“ wird zum Baukasten, hinter dem kaum noch jemand sitzt.
Und dann dieser Moment, in dem du suchst und gar nicht mehr klickst. Warum auch? Die Antwort steht ja schon da, als AI-Zusammenfassung über den Suchergebnissen. Eine Studie zeigt: Wer diese Zusammenfassungen sieht, klickt halb so oft auf die eigentlichen Links. „Zero-Click" als Standard. Für Nutzer bequem, für das Ökosystem schlicht fatal: Inhalte verschwinden im Strom der Zusammenfassungen, Herkunft wird Beiwerk.
Gleichzeitig schickt eine neue Bot-Spezies unermüdlich Späher los: „Retrieval-Bots“, die in Echtzeit Seiten scannen, um Antworten für Chat-Assistenten zu füttern. Ihr Traffic ist dieses Jahr um knapp die Hälfte gewachsen; im März allein zählten Observers über 26 Millionen Abrufe, die Blocker umgingen. Das ist nicht nur Technik, das ist Machtverschiebung: von der Suche zum Dialog, vom Link zur Synthese, vom Urheber zur Maschine, die aus allem eine Antwort baut.
Natürlich bleibt die alte Bot-Ökonomie auch nicht gerade stehen. Bewertungen sind ihr Lieblingsbiotop. Amazon meldet, allein 2024 275 Millionen verdächtige Fake-Reviews blockiert zu haben. Und eine Regierungsanalyse im Vereinigten Königreich kam bereits vorher zu dem Schluss, dass 11–15 % der Elektronik-Reviews gefälscht sein könnten. Das ist keine Randnotiz; das ist der Boden, auf dem wir Kaufentscheidungen treffen.
„Na und?“, sagst du. „Ich kann Fake doch riechen.“ Sicher? Maschinen sind nicht nur schneller; sie sind ja vor allem unendlich geduldig. Sie erfinden eine plausible Biografie, hören deine Vorlieben ab, imitieren deinen Ton. Und sie werden billiger. Wo früher ein Troll-Arbeiterzimmer 50 Accounts betreute, orchestriert heute ein Skript 5.000. Das ist der eigentliche Skandal: Nicht der eine Shitstorm, sondern das dauerhafte Rauschen, die synthetische Zustimmung, der künstliche Widerspruch, das weichgespülte „Vielleicht“, das jede klare Aussage in Watte packt.
Und ja, immer häufiger wird es leider politisch. Es gibt inzwischen komplette Website-Netzwerke, die mit KI-Textern so tun, als wären sie Lokalmedien, speziell darauf ausgerichtet, Wähler in Europa zu beeinflussen. Auch daran sieht man: Das Problem ist nicht die KI per se, sondern die Skalierung der Täuschung.
Was ist denn die Wahrheit? Wofür stehen wir noch? Welche Stimme verstärken wir? Und welche nicht?
Und nun?
Dazu drei Gedanken. Unheroisch, aber ziemlich wirksam:
1) Herkunft wird Feature. Wenn jede Seite zur Maschine sprechen muss, braucht jede Seite maschinenlesbare Etiketten: Wer hat’s gemacht, wann, womit? Content-Credentials (C2PA & Co.) sind kein Nice-to-have, sondern die neue Signatur. Wer seine Arbeit liebt, signiert sie auch.
2) Misstrauen neu kalibrieren. Wir müssen uns an einen merkwürdigen Reflex gewöhnen: Glauben auf Probe. Nicht zynisch, auch nicht paranoid, einfach prüfend. Zwei Klicks mehr, ein Blick ins Impressum, ein kurzer Quercheck. „Too good to be true“ bleibt ein verlässlicher Sensor.
3) Menschliche Ecken feiern! Alles, was unökonomisch ist, wird wertvoller: die schräge Metapher, der Tippfehler, die kleine Härte in einem Satz, der nicht allen gefällt. Das sind die Kanten, an denen du merkst: Hier schreibt jemand, der keine Angst davor hat, etwas zu riskieren. Maschinen glätten. Menschen entscheiden.
Und nein, früher war nicht alles besser! Ich liebe die Bots. Sie bezahlen meine Parktickets, füllen Formulare aus, retten mich vor der Hotline-Hölle. Ich will nicht zurück in eine Welt voller Faxgeräte und Öffnungszeiten.
Ich will nur wissen, wann ich mit einem Menschen spreche und wo ich einer Maschine höflich danke und dann lieber nochmal selbst nachsehe.
Wir werden einfach lernen müssen, in einer halbsynthetischen Öffentlichkeit zu leben: teilautomatisiert, teilbegeistert und teilskeptisch.
Und wenn das gelingt, hat die Maschine ihren Platz.


