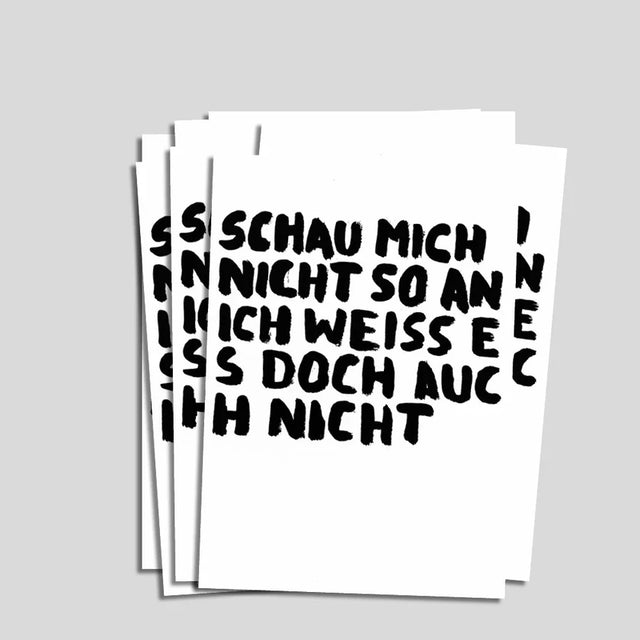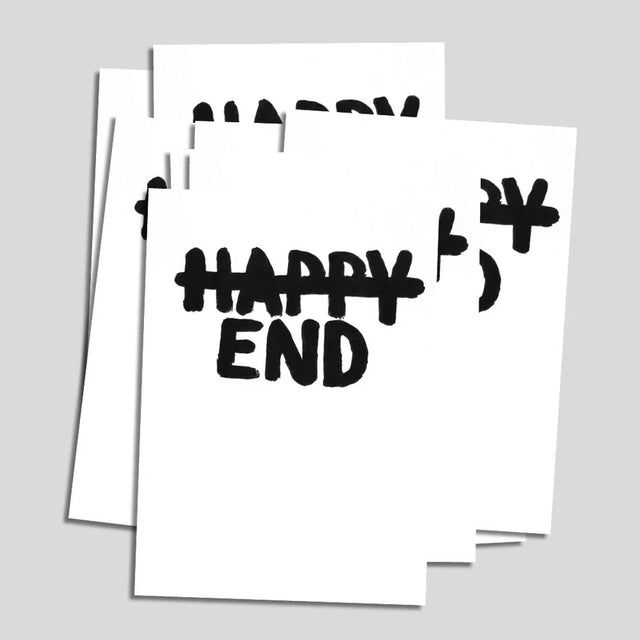Beruf: Mensch
Jürgen Nerger – 05. August 2025Warum die Jobs der Zukunft am Leben selbst arbeiten
Es gab Zeiten, da galt ein sicherer Job für die meisten Menschen als höchstes Ziel. Als solide Lebensgrundlage. Feste Arbeitszeiten, Rentenanspruch, Krankenkasse. All das war zwar nicht unbedingt sexy, aber stabil. Dann kam die Idee von Selbstverwirklichung. Startup-Kultur, New Work, Freelancer-Life. Jeder war plötzlich Entrepreneur, Creator, Berater, Coach. Die Begriffe wechselten, die Unsicherheit blieb. Und der Traum von Freiheit war oft nur ein Umweg zur Selbstausbeutung.
Siehe da, nun geraten selbst die Leuchttürme dieser neuen Arbeitswelt ins Wanken. Silicon Valley entlässt in Scharen. Die einstige Avantgarde der App-Entwickler:innen, UX-Designer:innen und Growth Hacker hat plötzlich Konkurrenz. Nicht aus China, nicht aus Indien, sondern direkt aus dem eigenen Serverraum. Künstliche Intelligenz erledigt jetzt auch ihre Aufgaben schneller und billiger. Und mit weniger Beschwerden über unbezahlte Überstunden.
Die Verheissung der letzten zwanzig Jahre – Mach dein eigenes Ding, werde dein eigener Boss, gründe ein Startup, das niemand braucht, aber alle finanzieren – verblasst. Wer heute ein Berufsfeld wählen will, steht vor einer paradoxen Situation. Alles scheint möglich, aber kaum etwas sicher. Die Berufe, die mit Schlagworten wie „Disruption“ und „Innovation“ geflutet wurden, entpuppen sich als seltsam volatil. Als technische Dienstleistung, die nun von noch technischeren Diensten ersetzt wird. Schon absurd oder?
Rückblick
Um das richtig einordnen zu können, vielleicht ein kurzer Blick zurück: Die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts hat erstmals Arbeit in großer Zahl vom Land in die Fabriken geholt. Das 20. Jahrhundert hat diese Bewegung perfektioniert. Mit Fließbändern und Massenproduktion. Es folgte der Übergang zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, in der nicht mehr das Produkt, sondern die Idee zählte. Beratung, Medien, Technologie wurden zu den neuen Leitbranchen. Heute leben wir in der sogenannten "postindustriellen Gesellschaft“ und das Modell kippt erneut. Denn Wissen, lange als unantastbare Ressource gefeiert, wird nun auch automatisiert. Ideen, einst menschliches Alleinstellungsmerkmal, werden schlicht maschinell reproduzierbar. Herzlich Willkommen im Zeitalter der Rechenleistung.
Selbst Startups schrumpfen also. Die Kreativwirtschaft sowieso. Wer braucht noch eine Grafikdesignerin, wenn eine KI ein Logo in Sekunden generiert? Wer zahlt für Texte, wenn eine Maschine Worte so formt, dass sie klingen wie echt? Das gilt genauso für die Musik, den Film oder das Foto. Die Ökonomie der Ideen hat ihre eigene Überflüssigkeit produziert. Und nun stellt sich die Frage: Was bleibt?
Die Antwort kann dann ja offensichtlich nur so lauten: das, was sich nicht digitalisieren lässt. Die Tätigkeiten, die so grundlegend sind, dass sie keiner technischen Optimierung bedürfen. Pflege. Handwerk. Gastronomie. Geburtshilfe. Landwirtschaft. Oder all das, was direkt mit Leben zu tun hat. Mit Körpern, Bedürfnissen, Gesprächen. Es gibt keine App, die eine Mahlzeit kocht, serviert und das Lächeln dazu liefert. Keine Plattform, die einen Menschen pflegt, ihn wäscht, ihm zuhört. Keine KI, die echte Berührung ersetzt und keinen Algorithmus, der echte Anwesenheit simuliert. Jedenfalls noch nicht.
Erkenntnis
Diese Erkenntnis bedeutet übrigens nicht, dass technische Berufe überflüssig werden. Im Gegenteil: Sie stehen vor einer Neuverortung. Ingenieur:innen, IT-Expert:innen, Techniker:innen werden gebraucht. Nur nicht für den nächsten Hype, sondern für den Erhalt und die Gestaltung von Infrastruktur, Energie, Verkehr, Kommunikation. Auch Technik will ja gepflegt werden. Auch Technik braucht Menschen, die sie verstehen, überwachen, verantworten. Zukunft ist also nicht nur Bedienung von Maschinen, sondern Verantwortung für ihre Wirkung. Die Technikberufe der Zukunft arbeiten dann eben nicht mehr an der nächsten App, sondern an der Basis des Zusammenlebens. Und müssen, ganz unironisch, liefern.
Es sind Berufe, die nicht nur Systeme bauen, sondern sie auch begleiten. Die sich nicht hinter Codes verstecken, sondern Verantwortung tragen für das, was Technik auslöst. In diesem Sinn gehören auch der Techniker, die Entwicklerin, der Systemarchitekt zu den Berufen am Leben selbst, weil sie eben mitentscheiden, wie sich dieses Leben gestaltet. Sie bieten aber keine absolute Sicherheit, sondern sind Teil einer beschleunigten, oft krisenanfälligen Dynamik, die ständige Anpassung verlangt.
Wer in dieser Welt plant, in drei Jahren noch genau das zu tun, was er heute tut, sollte besser nicht in der Technik arbeiten.
Oder gar nicht arbeiten.
Sicherheit, so zeigt sich, liegt nicht mehr im Fortschritt allein. Sie liegt in der Unverzichtbarkeit. In Aufgaben, die sich nicht einfach überschreiben lassen und in Berufen, die bleiben, weil Menschen bleiben. Wer eine Mahlzeit braucht, braucht jemanden, der sie kocht (auch wenn man nur so einen furchtbaren Thermomix bedient). Wer krank ist, braucht jemanden, der heilt. Wer lebt, braucht jemanden, der da ist. Solide, anwesend, analog.
Vorschau
Die Arbeitswelt der Zukunft wird nicht durch noch mehr Technik erlöst. Sie wird erlöst durch eine Rückkehr zum Wesentlichen. Wo kann ich wirken, ohne dass meine Arbeit sofort entwertet wird? Klingt irgendwie nach Verzicht, ist aber ein echter Gewinn. Denn inmitten von Automatisierung und Optimierung entsteht so, ganz nebenbei , eine neue Art von Relevanz: Berufe, die nah am Leben sind, an Menschen, an echten Bedürfnissen. Sie sind vielleicht nicht prestigeträchtig, nicht viral, nicht skalierbar. Aber sie sind das, worauf am Ende alles hinausläuft: Essen, Schlaf, Gesundheit, Beziehung. Und eben auch: Technik, die funktioniert und dem Menschen dient.
Was daraus folgt, ist dann auch mehr als eine wirtschaftliche Neuorientierung. Es ist eine kulturelle Wende. Wer heute einen Beruf wählen will, sollte sich nicht fragen: Wie werde ich reich? Auch nicht: Wie bleibe ich relevant? Sondern: Wie bleibe ich gebraucht? Und die Antwort liegt nicht im Metaverse, sondern im echten Leben. Und womöglich (man wird ja noch träumen dürfen) wird das alles dazu führen, dass wir ein paar Dinge, die wir für Fortschritt hielten, einfach wieder abschaffen. Plattformen, die Kreative entmündigen. Prozesse, die das Menschliche aus der Arbeit extrahieren. Und vielleicht geben wir den Künstler:innen, Musiker:innen, Designer:innen dann ihre Autonomie zurück. Nicht aus Nostalgie, sondern weil wir verstanden haben, dass es nicht nur um das Bild, den Song, das Produkt geht, sondern um die Geschichte dahinter. Um die Person, die es gemacht hat.
Die Zukunft der Arbeit ist kein technisches Problem mehr. Sie ist eine Frage der Haltung.
Und des Handwerks.